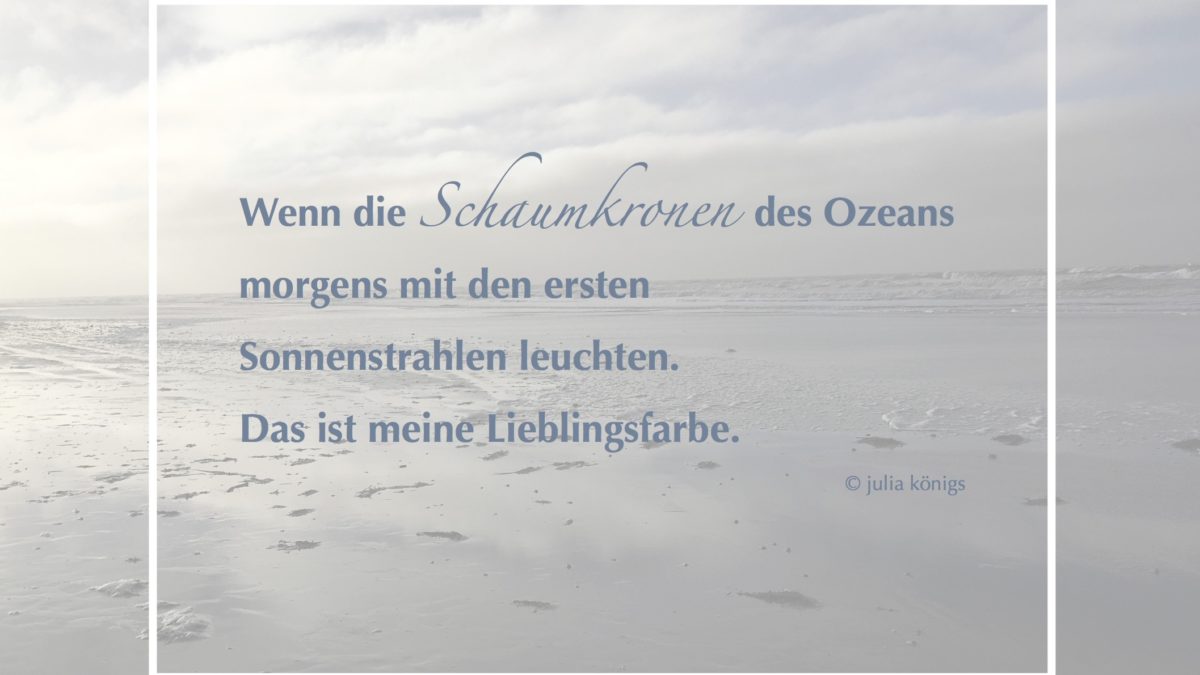Die feine Späne sammelte sich zwischen seinen Handflächen. Behutsam fuhr er durch die Splitter, die nicht mehr scharf und rissig waren, sondern angenehm, wie Sand, der einem durch die Zwischenräume der Finger rinnt. Langsam klopfte er die Handflächen aneinander, beobachtete, wie der Holzstaub durch die Luft waberte. Dann steckte sich seine Pfeife an.
Auf seiner Werkbank stand, poliert und glattgeschliffen, eine Schatulle. Seit zwei Tagen arbeitete er an diesem Stück, das nur wenig größer war als eine seiner Handflächen. Fünf hatte er schon geschafft: Sie standen geöffnet auf den drei Fensterbänken seiner Hütte, ausgekleidet mit Leinenresten. Darin seine Schätze: Kleine und große Kaurimuscheln, runde und gerillte Herzmuscheln, winzige Kreiselschnecken, Nadelschnecken, in sich verdrehte Mondschnecken, schwarze Miesmuscheln, die Hälften zweier noch immer verbundener Trogmuscheln, Sägezähnchen mit kratziger Oberflächenstruktur, gezackte Purpurschnecken mit weiten Öffnungen. Manchmal presste er sich eine der Schnecken fest ans Ohr, kniff die Augen zusammen, lauschte. Er bekam selten eine Antwort.
Mit seiner Pfeife setzte er sich unter eines der Fenster, hüllte sich in würzigen Rauch und sah hinaus. Um seine Hütte türmte sich weißer Sand, wuchsen immergrüne Bananenstauden, dicke Palmen, Farne, ihre Blätter so lang, dass er sie hin und wieder beschneiden musste, damit sie die Tür seiner Hütte nicht überwucherten. Sicher, ein paar Leute wären froh gewesen, wenn der Farn seine Tür versperren würde, ihn einsperren würde, den schweigsamen Einsiedler. Seltsam. Kauzig. Verrückt.
Es störte ihn nicht, was sie über ihn sagten. Aber es schmerzte ihn, wenn er daran dachte, dass niemand von ihnen auch nur einen seiner Muschelschätze benennen konnte. Niemand erinnerte sich daran, dass das Meer diese Juwelen preisgab – niemand erinnerte sich an das Meer.
Der Strand vor der Hütte war heute besonders stark besucht. Familien hatten sich auf den bunten Liegen ausgebreitet, Handtücher hervorgeholt, ein Picknick ausgepackt. Während er seine Pfeife neu stopfte, sah er seine kleine Freundin – die einzige, die er hatte – wieder am Strand saß. Sie wirkte in ihre eigenen Gedanken versunken, wie sie da auf dem Bauch lag, ihre Liege zwischen den beiden mit warmem Wasser gefüllten Becken. Das war es, was die Menschen hier den Strand nannten. Er beobachtete sie.
Foto: MabelAmber // CC0 1.0
Kalt und klar umfloss das Wasser ihre Finger. Tropfen sammelten sich in den Zwischenräumen, wenn sie die Hand etwas krümmte und wieder streckte. Sie erinnerte sich daran, was sie über Staudämme und Schiffe gelesen hatte und fand es einleuchtend, dass auch ihre kleine Hand ein Staudamm oder ein Schiff sein konnte, wenn sie es wollte.
Einmal werde ich Seglerin, hatte sie ihrer Klasse verkündet. Ich werde mir ein Schiff bauen und segeln, ein Abenteuer suchen. Meint ihr nicht, dass es so ein richtig großes Meer gibt? Weitere draußen? Wer kommt mit auf mein Schiff?
Aber keiner hatte die Hand gehoben, nicht einmal Mina, und Mina war ihre Sitznachbarin, mit der sie immer ihr Obst teilte. Da waren bloß angsterfüllte Blicke gewesen, die ihr sagten, dass sie auf sich allein gestellt war.
Schön, dachte sie, dann wird mein Abenteuer eine Einmannfahrt. Es gibt bestimmt auch kleine Boote.
Aber in welcher Richtung lag das Meer? Seufzend zog sie ihre Hand aus dem Rinnsal, das sich im Sand zwischen ihrem Liegestuhl und dem ihres Vaters gebildet hatte. Sie rollte sich auf die andere Seite. Tropische Blumen füllten die Luft mit ihrem schweren, süßen Duft, den sie nicht besonders mochte. Er passte nicht zur frischen Kühle des Wassers. Auch das Glas, das neben ihr aufragte, war kühl. Das Glas, das ihre Welt umschloss. Tiefes Blau füllte das Draußen dahinter, nur manchmal leuchteten winzige Lichtpunkte auf, wenn man die Augen fest auf einen Fleck richtete und lange wartete. Manche Leute sagten, dass es gleißende Schauer aus diesen Lichtpunkten gegeben hatte, vor langer Zeit.
Sie hatte nie einen der Schauer gesehen. Vielleicht war es nur eine dieser Geschichten, die man sich erzählte, weil man sich nicht mehr an die Wahrheit erinnern konnte? Das behauptete der alte Mann in der Hütte jedenfalls.
Sie klopfte sanft mit den Knöcheln gegen das Glas. Es war so fest, dass es kein Geräusch gab.
Wie groß war dieses Draußen hinter dem Glas? Tausende, Abertausende Kilometer? Oder gab es nur einen sehr dünnen Vorhang, hinter dem eine andere Welt wartete, die, genau wie ihre Welt, einen Vorhang hinter einer Scheibe beobachtete und sich fragte, ob es das große Meer gab, das die Welten vielleicht miteinander verband?
Ihre Lehrerin mochte es nicht, dass sie sich zu viele Gedanken machte, sich Geschichten ausdachte.
Sieh es doch ein, Ava, sagte sie dann immer, da draußen ist nichts. Nichts, wovor du dich fürchten brauchst.
Ich fürchte mich nicht, antwortete sie jedes Mal.
Dann gibt es dort auch nichts, wovon zu träumen kannst, sagte die Lehrerin.
Ava war sich trotzdem sicher, dass es mehr gab. Sie spreizte ihre Finger weit und legte die Handfläche auf das Glas. Wollte hindurch greifen und einen dieser Lichtpunkte fassen.
Ava, bringst du mir eine Limonade? Ihr Vater schob seine Sonnenbrille auf dem Nasenrücken wieder hinauf, gähnte, faltete seine Hände auf seinem Bauch.
Orange oder Limette?, fragte Ava.
Wie wäre es heute mal mit Himbeere, murmelte er schläfrig.
Ava ließ vom Glas ab, schlüpfte in ihre Sandalen und stieg zwischen mehreren Liegestühlen zum Hang, der hinter der Glaskuppel, dem Sand, den Tropenpflanzen und den beiden Wasserbecken aufragte.
Der alte Mann sah, wie Ava in ihrem dunkelblauen Badeanzug den Hang hinauf kam. Vielleicht wollte sie zum Kiosk nebenan. Dort kauften die Leute alles, was sie für einen Tag hier brauchten: Sandwiches, Limonade, Eiscreme, Badetücher, Wasserbälle, Wurfscheiben, Schwimmflügel, Rettungsringe. Keine Sonnencreme.
Er beobachtete, wie Ava eine ihrer Sandalen verlor, wieder überstreifte, hierhin und dorthin hüpfte. Nach einer Weile hob sie den Kopf und winkte. Er hob seine freie Hand und winkte zurück. Er trat vom Fenster zurück und strich mit den Finger über den Rand der frisch bearbeiteten Muschelschatulle, klein und perfekt.
Ava klopfte an seinen geöffneten Fensterladen.
„Hallo Giacomo“, sagte sie. „Darf ich reinkommen?“ Sie huschte durch die Eingangstür. „Was hast du heute gebaut?“ Ihre Finger, die immer in Bewegung waren, fuhren über seine Werkbank. Sie wusste, dass er seine Tage damit zubrachte, Holz zu schneiden, zu schleifen, zu lasieren, Sägemehl aufzukehren. Der Holzstapel in seinem Lager wurde schmaler und schmaler.
„Hier“, sagte Giacomo, schon seine Pfeife in den rechten Mundwinkel und deutete auf die neue Schatulle. „Für dich.“
Ava starrte ihn an. Er schaute weg, weil er ihre Kinderaugen nicht lange aushalten konnte.
„Sie ist schön“, sagte Ava und nahm die Kiste in die Hände. In ihren Fingern wirkte die Schatulle genau richtig; nicht so verloren wie in seinen. Ava nahm die Muschel heraus, die er dort für sie zwischen den Leinenstreifen versteckt hatte.
„Mondschnecke“, brummte er.
Nickend, als wüsste sie genau, was es bedeutete, ein besonders fein geratenes Exemplar einer Mondschnecke in den Händen zu halten, hielt sie das Gehäuse ins Licht, das durch das Fenster fiel.
„Meinst du, sie erinnert sich an den Mondschein auf der Meeresoberfläche?“, fragte sie. Giacomo stieß einen langen Rauchfaden aus seiner Pfeife aus und grummelte. „Kann ich doch nicht wissen, ob Muscheln fähig sind, sich an was zu erinnern“, sagte er.
„Ich meine“, sagte Ava hastig, „vielleicht hat sie den Mondschein in sich aufgesogen. Für immer.“
„Ich weiß nicht“, wiederholte er.
„Heute gibt es einen Vollmond“, sagte Ava, legte die Mondschnecke zurück in die Schatulle, schloss den Deckel und nahm sie mit zur Tür. „Schaust du ihn dir an?“
„Hm“, machte Giacomo, schob die Pfeife zwischen den Lippen herum.
„Ich habe ein Buch von Papa gelesen, heimlich“, stieß Ava dann hervor, schnell, sie hatte Angst, sich an den Worten zu verschlucken, wie sie sie nicht loswurde. „Da stand: Das Leben im Künstlichen Raum wurde ermöglicht, um die Bewohnenden vor der schädlichen Atmosphäre zu schützen. Aber was ist das, Atmosphäre? Giacomo? Warum müssen wir uns vor ihr schützen, wenn sie doch so schöne Dinge hervorbringt wie diese Mondschnecke? Wie den Vollmond? Wie … das Meer?“
„Ich kann es dir nicht erklären, Ava“, sagte Giacomo leise. „Du solltest deinem Papa seine Limo bringen.“ Er schob sie zur Tür. „Genug für heute.“
„Gibt es noch mehr wie uns da draußen, Giacomo?“, fragte sie, legte die Hand an den Fensterrahmen sein Hütte und schaute sehnsüchtig hinaus ins endlose Schwarz. Giacomo paffte und legte seine Hand auf ihre. Seine Finger waren lang, groß, schwielig. Es sah aus, als würde er ihre Hand verschlucken.
„Ava, wir sind allein hier oben.“
Seufzend schaute sie weiter hinaus, noch lange nachdem Giacomo sich eine neue Pfeife angesteckt hatte und sich in seinen Lehnstuhl zurücksinken ließ, die Augen geschlossen, die Hände um eine seiner bauchigen Trogmuscheln geschlungen, für die er morgen eine Kiste bauen würde.
Vielleicht wird ein Schiff kommen, dachte Ava, als sie ihrem Vater seine Limonade reichte. Dann werde ich einsteigen und das Meer sehen.
Dir gefällt, was du liest?
Dann stöbere gerne weiter durch meine Kurzgeschichten hier auf dem Blog.
Mehr Geschichten für unterwegs…
…findest du in all den Kategorien auf dem Blog oder unter dem Reiter Kurzgeschichten für unterwegs. Lies zum Beispiel gleich hier weiter:
- verbringe mit Birte eine Nacht am Strand im Dschungel Australiens
- erfahre, warum wir die Welt vor Overtourism bewahren sollten
- oder entdecke meine Kurzgeschichte Was ich dir noch sagen wollte
Du willst immer auf dem Laufenden bleiben?
Wissenswertes
Diese Geschichte entstand nach einem Aufruf des Literaturhauses Zürich, sich von einem Alltagsbild zu einem untypischen Twist der Story inspirieren zu lassen. Ich betrachtete das Bild eines Schwimmbads mit den Plastikbällen, künstlichen Palmen und einer gewölbten Decke über den Wasserrutschen – und da war meine Idee geboren.